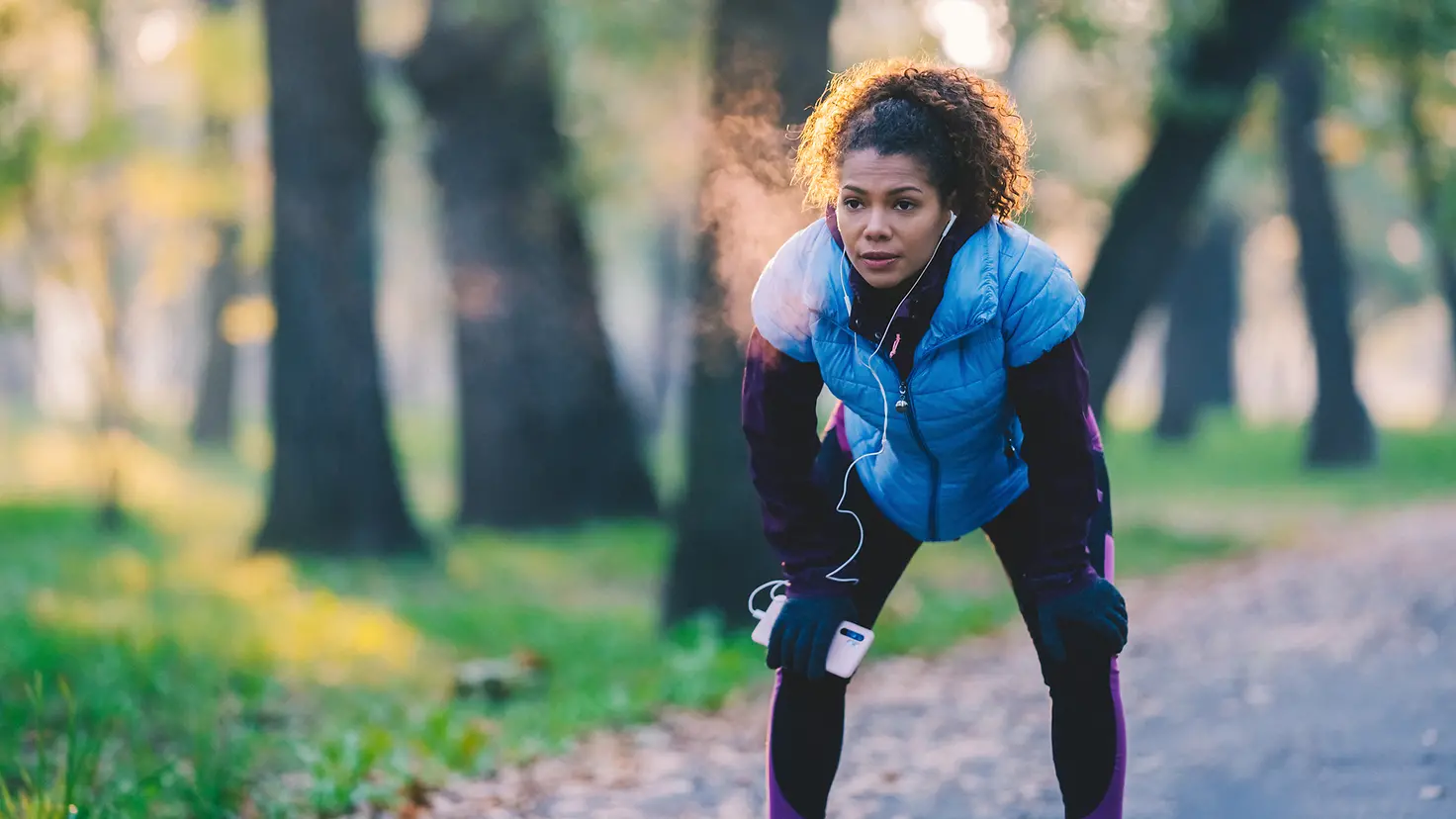- Warum ist geschlechtsspezifische Medizin so wichtig für uns alle?
- Jeder Mensch hat ein biologisches und ein soziales Geschlecht (Sex & Gender)
- Und wie viele Geschlechter gibt es?
- Nicht nur das Geschlecht spielt eine Rolle
- Krankheiten: Frauen und Männer erleben Symptome unterschiedlich
- Risiko für Krankheiten: Welche Rolle spielt das Geschlecht?
- Psychische Gesundheit: Auch Männer bekommen Depressionen
- Frauen und Männer vertragen Medikamente unterschiedlich
- Wie sieht die Zukunft der Medizin für uns aus?
Wir sind nicht alle gleich – jeder Mensch ist einzigartig. Das haben wir alle schon oft gehört. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht, steckt viel mehr dahinter, als man zunächst vermutet. Denn wie wir krank werden und wie die beste medizinische Behandlung für jeden einzelnen Menschen aussieht, hängt von vielen Faktoren ab.
Nicht zuletzt spielt dabei unser Geschlecht eine Rolle. Männer, Frauen und diverse Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn es um ihre Gesundheitsversorgung geht. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden dabei aber bisher noch viel zu wenig berücksichtigt.
Teilweise hat das einfache Gründe: beispielsweise ist in der medizinischen Forschung und Lehre der „Durchschnittsmensch“ in der Regel immer noch männlich. Die Gendermedizin sieht das anders: Sie berücksichtigt geschlechtsspezifische Unterschiede und will dadurch die Gesundheitsversorgung für alle Menschen verbessern. Deshalb setzt die Barmer sich für geschlechtersensible Medizin ein.
Warum ist geschlechtsspezifische Medizin so wichtig für uns alle?

„Wir orientieren uns in der Medizin generell zu stark an einem Durchschnittsmenschen, den es so nicht gibt“, sagt Prof. Dr. Christoph Straub, der Vorstandsvorsitzende der Barmer. Die Studienlage zu diesem Thema ist eindeutig: Es gibt zahlreiche geschlechterspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und diese Unterschiede beeinflussen, wie Erkrankungen entstehen, diagnostiziert werden, verlaufen und behandelt werden. „Frauen sind eben keine kleineren, leichteren Männer“, stellt Prof. Dr. Straub klar.
Die Gendermedizin berücksichtigt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und zwar nicht nur in biologischer Hinsicht, sondern auch mit Blick auf sozialpsychologische Unterschiede – also auf das Verhalten von Menschen in ihrem sozialen Kontext. Die Gendermedizin wird daher auch geschlechtssensible Medizin genannt. Das Geschlecht eines Menschen ist mitverantwortlich dafür, wie wahrscheinlich sich bestimmte Erkrankungen entwickeln, mit welchen Symptomen sich Krankheiten äußern und wie die beste Behandlung aussieht.
Jede und jeder einzelne von uns profitiert davon, um geschlechtsspezifische Unterschiede zu wissen und Symptome erkennen zu können. Vor allem das Gesundheitswesen muss sich stärker mit dem Thema Geschlechtermedizin auseinandersetzen.
Ihr Newsletter für ein gesünderes Leben
Jetzt unverbindlich anmelden und monatlich Gesundheitsthemen mit wertvollen Tipps erhalten und über exklusive Barmer-Services und -Neuigkeiten informiert werden.
Newsletter abonnieren
Für Ärzte bedeutet das zum Beispiel, dass sie sich dem Thema schon im Medizinstudium systematisch annähern. Momentan werden geschlechtsspezifische Unterschiede in der medizinischen Lehre nur punktuell behandelt und nur wenige deutsche Fakultäten und Lehrbücher setzen sich systematisch und umfangreich mit der Problematik auseinander. Das ändert sich glücklicherweise:
Ab dem Jahr 2025 gilt eine neue Approbationsordnung, die geschlechtsspezifische Unterschiede in den Lehrplänen des Medizinstudiums verankert. Gendermedizin ist kein Nischenthema mehr: Sie ist ein wachsender Wissenschaftsbereich, der das Potenzial hat, die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern.

Jeder Mensch hat ein biologisches und ein soziales Geschlecht (Sex & Gender)
Der Unterschied zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht wird in der englischen Sprache etwas klarer, denn dort gibt es zwei unterschiedliche Wörter: „sex“ und „gender“. Das biologische Geschlecht (sex) beschreibt körperliche Merkmale wie Chromosomen, Gene, Anatomie und Hormone. Außerdem unterscheiden sich Menschen je nach Geschlecht durch die Aktivität ihres Immunsystems und ihrem Stoffwechsel.
Das soziale Geschlecht (gender) bezieht sich auf Verhaltensweisen, die oft mit gesellschaftlichen Normen und geschlechtstypischen Lebensstilen verknüpft sind. Das beinhaltet, wie wir uns selbst in unserem Umfeld fühlen. Gender umfasst also auch unsere Selbstwahrnehmung, unsere Identität und in welchem Geschlecht wir uns empfinden. Die meisten Menschen lernen von klein auf, welche Verhaltensweisen „typisch“ für Männer oder Frauen sind. Häufig sind damit klassische Rollenerwartungen und Stereotypen verknüpft, die wir durch die Gesellschaft erlernen und übernehmen.

Wie das biologische und das soziale Geschlecht unsere Gesundheit beeinflussen.
Das biologische und das soziale Geschlecht beeinflussen sich gegenseitig und beide nehmen Einfluss auf die Gesundheit und Krankheit eines Menschen. Dabei kann auch das soziale Geschlecht ausschlaggebend sein, ob man an bestimmten Krankheiten wie Rheuma oder Darmerkrankungen leidet und wie früh diese Krankheiten erkannt werden. Die Verhaltensweisen, die wir durch unsere soziale Umwelt erlernen, unser Umfeld und unsere Erfahrungen haben also Anteil an unserer Gesundheit. Dazu gehören Faktoren wie der Arbeitsplatz, Familienrollen, Risikofreude, emotionale Intelligenz, Unterstützungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld und auch Diskriminierungserfahrungen.
Die geschlechtssensible Medizin berücksichtigt sowohl das biologische als auch das soziale Geschlecht von Menschen.
Und wie viele Geschlechter gibt es?
Häufig sortieren wir Menschen wegen typischen, äußerlichen Körpermerkmalen automatisch in zwei Geschlechter: Männer und Frauen. Dabei handelt es sich um eine binäre („paarweise“) Sichtweise, die weit verbreitet ist.
Tatsächlich ist das biologische Geschlecht in der Natur allerdings nicht binär – weder bei Menschen noch bei Tieren. Wenn Menschen biologisch nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, gelten sie als intergeschlechtlich oder inter*. Sie können zum Beispiel gleichzeitig mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Häufig führen Ärztinnen und Ärzte dann eine genetische Untersuchung durch und weisen dem Kind gemeinsam mit den Eltern das weibliche oder männliche Geschlecht zu.
Ob sich das Kind später auch mit diesem Geschlecht identifizieren kann, ist nicht vorhersagbar. In Deutschland gibt es seit 2013 daher für Eltern die Möglichkeit, diese Zuweisung auszulassen oder stattdessen in der Geburtsurkunde des Kindes das Geschlecht „divers“ eintragen zu lassen.

Auch beim sozialen Geschlecht können sich Menschen jenseits von Mann oder Frau empfinden. Neben der sogenannten Mann-Frau-Dichotomie (Zweiteilung) können sich Menschen mit beiden, keinem oder weiteren Geschlechtern identifizieren.
Das soziale Geschlecht wird dann nicht-binär oder divers genannt. Menschen können sich mit ihrem bei der Geburt zugeordneten biologischen Geschlecht identifizieren (cis*). Sie können sich aber auch nur teilweise oder gar nicht mit ihrem zugeordneten Geschlecht identifizieren (trans*). Wenn das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht sich nicht entsprechen, kann das für den betroffenen Menschen eine psychische Belastung sein.
Menschen, die inter*, trans* oder divers sind, haben sehr individuelle Bedürfnisse bei ihrer Gesundheitsversorgung. Trotzdem sind nicht-binäre Menschen in Studien bisher nicht genug berücksichtigt. Das liegt unter anderem daran, dass sie im Vergleich zu cis-Menschen sehr viel seltener sind. Viele Ergebnisse der Gendermedizin beziehen sich deswegen bisher vor allem auf cis-Frauen und cis-Männer.
Nicht nur das Geschlecht spielt eine Rolle

Menschen sind verschieden. Wie sie medizinisch versorgt werden oder ob sie zum Beispiel Diskriminierung im Gesundheitssystem erleben, wird nicht nur vom Geschlecht, sondern von vielen Aspekten bestimmt: Alter, Bildung, ökonomischer Hintergrund, Kultur und Ethnie sind einige davon.
All diese Faktoren greifen ineinander und können beeinflussen, wie sich Symptome äußern oder wie Menschen therapiert werden. Das Zusammenspiel dieser Aspekte wird Intersektionalität genannt. Ökonomisch und sozial benachteiligte Frauen haben beispielsweise häufiger chronische Erkrankungen als Frauen mit höherem Einkommen und einem unterstützenden sozialen Umfeld.
Krankheiten: Frauen und Männer erleben Symptome unterschiedlich
Die Gendermedizin befasst sich auch damit, dass Krankheitsanzeichen bei Frauen und Männern unterschiedlich sein können. Bei einer Diagnosestellung können diese geschlechtsspezifischen Symptome einen wesentlichen Unterschied für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten machen.
Männer und Frauen können Krankheiten unterschiedlich erleben. Ärztinnen und Ärzte werden in ihrer Ausbildung aber noch nicht ausreichend zu geschlechterspezifischen Unterschieden geschult, wodurch Diagnosen in einigen Fällen erst verzögert gestellt werden. Die Ursache dafür liegt in einer Datenlücke (Gender Data Gap), die lange Zeit in der medizinischen Forschung bestand. In vielen Studien waren bis in die 1990er Jahre Männer der Standard, der teilweise auf Frauen übertragen wurde. Immer noch werden daher Symptome, die häufiger bei Frauen auftreten, manchmal nicht als spezifisch für Frauen, sondern als unüblich („atypisch“) beschrieben.
Ein Beispiel sind Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die lange als typische „Männerkrankheiten“ galten. Es stimmt: Frauen haben seltener Herzinfarkte als Männer. Aber sie sterben häufiger daran. Das macht es umso wichtiger, dass sich nicht nur Ärztinnen und Ärzte mit geschlechtsspezifischen Unterschieden von Krankheiten auseinandersetzen. Auch wir selbst sollten sie kennenlernen.

Atemnot, Rückenschmerzen und kalter Schweiß sind drei typische Symptome, die bei Frauen mit Herzinfarkt häufiger vorkommen als bei Männern.
Risiko für Krankheiten: Welche Rolle spielt das Geschlecht?
Frauen und Männer haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen. Das kann biologisch bedingt sein. Ein Beispiel: Menschen mit einer weiblichen Anatomie haben ein höheres Risiko eine Blasenentzündung oder andere Harnwegserkrankungen zu entwickeln. Das liegt daran, dass sie eine kürzere Harnröhre als Männer haben und Bakterien daher leichter zur Blase gelangen.
Aber auch bei schwereren Erkrankungen ist das Risiko unterschiedlich. Früher erkrankten Männer zum Beispiel häufiger als Frauen an Lungenkrebs. Der Grund dafür war der Lebensstil vieler Männer, der sich oft aus dem sozialen Geschlecht ergeben hat: Männer rauchten einfach häufiger Zigaretten als Frauen. Heutzutage rauchen Frauen fast so häufig wie Männer. Ihr Risiko für Lungenerkrankungen ist jedoch höher als bei Männern: Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Zigaretten auf Frauen gesundheitsschädlicher wirken als auf Männer. Außerdem erhöht das weibliche Hormon Östrogen, genauer dessen Stoffwechsel, das Risiko von Frauen, an Lungenkrebs oder Brustkrebs zu erkranken.

Frauen erkranken auch häufiger an Rheuma und haben dabei öfter stärkere Symptome als Männer. Die gute Nachricht: Die Behandlung von rheumatischer Arthritis verbessert sich laufend und in diesem Bereich wird auch zu geschlechtsspezifischen Therapien für Frauen geforscht.
Bei Darmkrankheiten können generell sowohl Männer als auch Frauen betroffen sein. Es gibt aber geschlechtsspezifische Muster: Männer erkranken häufiger an Darmkrebs, Frauen dagegen öfter am Reizdarmsyndrom. Früher wurden dafür oft die verschiedenen Ernährungsvorlieben und Lebensstile von Männern und Frauen verantwortlich gemacht.
Mittlerweile haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdeckt, dass unsere Darmflora auch durch geschlechterspezifische Darmbakterien beeinflusst wird. Außerdem stellen Frauen weniger Magensäure her, was sich auf die Verdauung auswirkt. Die Genderforschung ist in Sachen Darmgesundheit noch in den Kinderschuhen und wir werden in den nächsten Jahren noch viel mehr über geschlechtsspezifische Unterschiede lernen.
Brustkrebs (Mammakarzinom) ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen fast jeden Alters, jedes Jahr erhalten etwa 70.000 Frauen in Deutschland diese Diagnose. Doch was viele nicht wissen: Männer können ebenfalls Brustkrebs bekommen. In Deutschland erkranken jährlich 750 Männer daran neu. Und auch Essstörungen, die lange als „typisch weibliche“ Erkrankungen galten, nehmen generell zu und betreffen auch immer mehr Männer.
Psychische Gesundheit: Auch Männer bekommen Depressionen
Männlichkeit wird oft noch mit Stärke, Status und Dominanz assoziiert. Die Gesellschaft erzeugt dadurch für viele Männer den Druck, diesem Rollenbild zu entsprechen. Das kann ein großes Problem darstellen. Denn wenn Männer die Tendenz haben, keine „Schwäche“ zu zeigen und nicht über ihre Gefühle zu sprechen, können auch psychische Krankheiten wie Depressionen verborgen bleiben.
Ein solches Rollenbild kann die Gesundheit von Männern also negativ beeinflussen („toxische Männlichkeit“). Männer sterben drei Mal häufiger durch Suizide als Frauen. Der Zusammenhang zu männlichen Rollenbildern in der Gesellschaft ist bisher nicht ausreichend erforscht. Trotzdem wird es höchste Zeit, die Bedeutung von Männlichkeit neu zu denken.

Auch nicht-binäre Menschen sind durch den gesellschaftlichen Druck und Einfluss sowie durch Stigmatisierung überproportional anfällig für Depressionen. Laut einer neuseeländischen Studie haben sie sogar ein 5-mal höheres Risiko für Suizidversuche als cis*-Menschen.
Frauen und Männer vertragen Medikamente unterschiedlich
Am Beispiel von Krebsbehandlungen wird deutlich, dass Männer und Frauen auch Medikamente teilweise unterschiedlich verarbeiten und vertragen. Das kann Effekte darauf haben, wie gut die Medikamente wirken. Ärztinnen und Ärzte müssen das beachten, wenn sie Arzneimittel und deren Dosierung wählen. Sie sollten dabei nicht nur Unterschiede im Körpergewichte, sondern auch im Stoffwechsel berücksichtigen: Teilweise bauen Frauen Medikamente anders ab als Männer.
Wie sieht die Zukunft der Medizin für uns aus?
Die Gendermedizin dient nicht nur dazu, die medizinische Behandlung von Frauen zu verbessern und damit eine Gleichstellung zwischen Frauen und Männern herzustellen. Langfristig geht es um viel mehr. Denn das Geschlecht ist nur einer von vielen Faktoren, die beeinflussen, wie Menschen erkranken und in der Folge therapiert werden. Das Wissen über personalisierte Behandlungskonzepte wächst stetig. Als wichtiger Baustein individualisierter Behandlung ist die Genderforschung Voraussetzung, um allen Geschlechtern die für sie beste Gesundheitsversorgung anbieten zu können.

Personalisierte Medizin berücksichtigt Faktoren, die sich äußeren, inneren, kollektiven und individuellen Bereichen zuordnen lassen.
Dafür muss die Gendermedizin noch stärker als bisher in der Aus- und Weiterbildung von Menschen in Gesundheitsberufen und in der wissenschaftlichen Forschung verankert werden. Es gibt bereits erste Forschungseinrichtungen, die sich auf die Gendermedizin spezialisiert haben, wie zum Beispiel das Forschungszentrum Gender in Medicine an der Charité in Berlin.
Für eine optimale medizinische Versorgung von Individuen ist es hilfreich, wenn sich auch die Menschen selbst für ihre Gesundheit einsetzen. Dafür ist unter anderem mehr Bewusstsein für die sogenannte gemeinsame Entscheidungsfindung (englisch: Shared Decision Making) nötig: Patientinnen und Patienten sollten ermutigt werden, sich aktiv mit der Gendermedizin auseinanderzusetzen, sich in die Behandlung einzubringen und gemeinsam mit ihren Ärztinnen und Ärzten die Therapien zu wählen, die zu ihrem Leben passen.

Dass wir eine geschlechtersensible Medizin brauchen, ist Konsens. In der Praxis sehen wir aber, dass viel mehr Aufmerksamkeit für eine geschlechtersensible Behandlung notwendig ist. Und ich sehe auch einen großen Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung, wenn es darum geht, falschen Annahmen und Vorurteilen etwas entgegenzusetzen, gerade bei Krankheiten wie Herzinfarkt oder auch Depression.
Barmer-Vorstandsvorsitzender Christoph Straub.