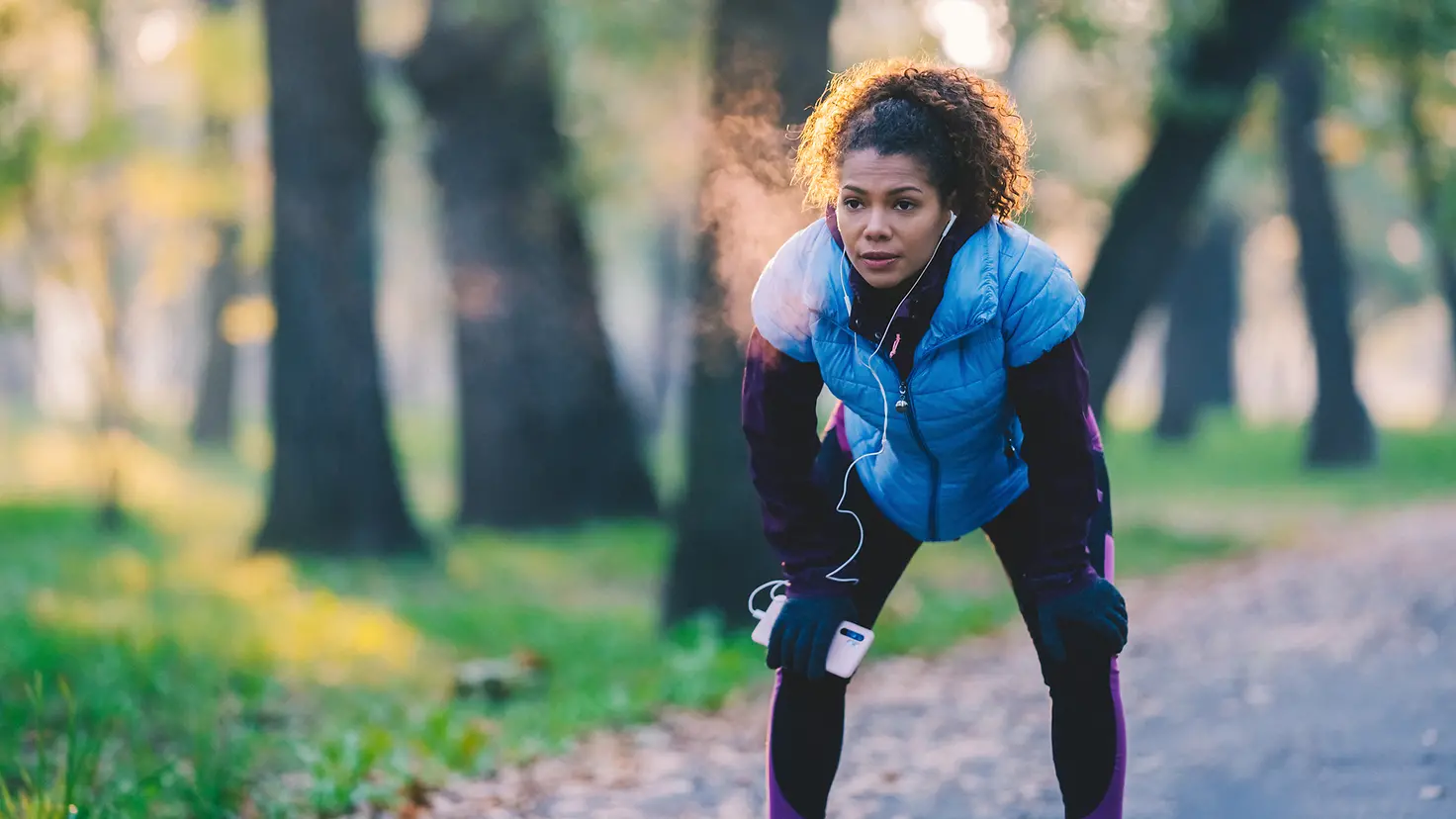Mit jährlich ca. 24.000 Patientinnen und Patienten ist das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) Köln eines der größten Krebszentren in Deutschland. Prof. Dr. Jürgen Wolf ist der Ärztliche Leiter des CIO Köln. Im Gespräch berichtet er über die Erfolge, die in den vergangenen Jahren durch eine genbasierte Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Lungenkrebs erzielt werden konnten. Und darüber, dass es auch und gerade der Therapie bei Frauen mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom zu verdanken ist, dass die Erkrankung heute nicht mehr als reine und „selbstverschuldete“ Männer- und Raucherkrankheit wahrgenommen wird. Unterstützung haben Wolf und das CIO Köln auf ihrem Weg schon sehr früh von der Barmer erhalten.
Herr Professor Wolf, Sie verfolgen im CIO Köln genbasierte, zielgerichtete Krebs-Therapien bei Lungenkrebs. Das heißt, Sie analysieren Krebszellen genetisch und suchen gezielt nach Merkmalen dieser Zellen, die eine medikamentöse Bekämpfung möglich machen. Ist die Therapie immer geschlechtsunabhängig möglich - oder gibt es eventuell Gen-Merkmale, die bei Frauen und Männern unterschiedlich häufig sind und damit auch die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Behandlung beeinflussen?
Wolf: Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede bei der Behandlung zwischen Mann und Frau. Bezüglich der Erfolge der Behandlung erleben wir aber schon Unterschiede aufgrund der Tatsache, dass unser Behandlungsansatz eben auf dem Nachweis von Treibermutationen des Tumors beruht - also jenen genetischen Veränderungen des Tumors, die ihn im Wachstum antreiben. Diese Treibermutationen finden wir mittlerweile bei circa der Hälfte der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Viele dieser Treibermutationen kommen deutlich häufiger bei Frauen vor, zum Beispiel die EGFR-Mutation. Wir haben es in diesen Fällen, das sind etwa 20 bis 25 Prozent der Adenokarzinome der Lunge, insgesamt nicht mit dem typischen langjährigen männlichen Raucher zu tun, sondern häufig mit Frauen, die nie geraucht haben.
Schaut man sich also die Lungenkrebspatienten in ihrer Gesamtheit an, haben Frauen häufig eine bessere Prognose, weil diese Mutationen bei ihren Tumoren häufiger vorkommen. Betrachten wir nur Patienten mit solchen Treibermutationen, dann sprechen Mann und Frau eigentlich vergleichbar auf die Therapie an.
Wie verhält es sich in der Bevölkerung mit Blick auf Zigarettenkonsum und Lungenkrebs? Stimmt die Vermutung, dass der Lungenkrebs weiblich wird, weil die Frauen heute eben häufiger zur Kippe greifen, während der Marlboro Man für immer weniger Männer ein Vorbild ist?
Wolf: Der Anstieg der Lungenkrebserkrankungskurve ist bei den Frauen noch im Gang, während diese Kurve bei den Männern im Sinken begriffen ist. Früher war die Verteilung etwa 80 zu 20. Heute sind wir bei einer Verteilung von etwa zwei Dritteln zu einem Drittel. Die Frauen haben in etwa 20 Jahre später angefangen zu rauchen, und das sehen wir jetzt an den Neuerkrankungen. Das ist das eine. Davon unabhängig ist aber unser personalisierter, genbasierter Therapieansatz und die unterschiedliche Häufigkeit der Mutationen bei Frau und Mann zu betrachten.
Das ist das Centrum für Integrierte Onkologie CIO Köln
Das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) ist das Krebszentrum der Uniklinik Köln. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 arbeiten im CIO Köln alle Kliniken und Institute der Uniklinik Köln zusammen, die sich mit der Diagnose und Behandlung und der Erforschung von Tumorerkrankungen befassen. In Tumorkonferenzen und Spezialsprechstunden stimmen die Spezialisten der verschiedenen Disziplinen gemeinsam die Diagnosen und Therapieempfehlungen für ihre Patientinnen und Patienten ab. Deutschlandweite Beachtung gefunden haben die Erfolge in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom anhand der molekulargenetischen Suche nach sogenannten Treibermutationen der Krebszellen. Das CIO Köln ist Teil des Centrums für Integrierte Onkologie Aachen Bonn Köln Düsseldorf, einem von 14 "Onkologischen Spitzenzentren" in Deutschland. Zusammen mit dem Westdeutschen Tumorzentrum Essen bildet es außerdem das Cancer Research Center Cologne Essen.
Lässt die Zahl der Erkrankten für beide Geschlechter heute fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu?
Wolf: Ja, Lungenkrebs ist in Deutschland und weltweit immer noch die häufigste Krebstodesursache. Das wird auch noch eine ganze Weile lang so bleiben. Wir können also für Frauen und Männer zuverlässige Aussagen treffen.
Zeigt sich Lungenkrebs unterschiedlich zwischen Frau und Mann? Zum Beispiel mit Blick auf den Zeitpunkt der Entdeckung der Erkrankung?
Wolf: Da der Lungenkrebs aufgrund der Einteilung nach Treibermutationen nicht mehr als eine einheitliche Erkrankung angesehen wird, und die Treibermutations-positiven Fälle vor allem bei Frauen, die nie geraucht haben, auftauchen und zumeist den histologischen Subtyp Adenokarzinom zeigen, kann man hier im klinischen Erscheinungsbild und der Art der Behandlung schon einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellen. Innerhalb so einer Gruppe ist der Unterschied dann aber eher zu vernachlässigen. Interessant mit Bezug auf die Früherkennung ist die Tatsache, dass die Sterblichkeit durch jährliches CT-Screening auf Lungenkrebs laut einer großen europäischen Evaluations-Studie bei Frauen deutlich stärker verringert werden könnte als bei Männern. Eine Erklärung hierfür gibt es bislang noch nicht.
Frage: Gibt es zwischen Mann und Frau Unterschiede, wie beide Geschlechter mit der Therapie umgehen und sich an diese halten?
Wolf: Dazu gibt es beim Lungenkrebs noch keine aussagekräftige Forschung. Wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, die unmittelbar bedrohlich ist und deren Gefahr unseren Patienten sehr präsent ist. Da sehen wir im Therapieverhalten schon deutliche Unterschiede zu chronischen Erkrankungen wie dem Bluthochdruck – oder auch einer Chronischen myeloischen Leukämie, mit der die Patienten durchaus 30 Jahre lang leben können und in deren Verlauf sie die Therapie vielleicht irgendwann etwas lockerer nehmen.
Beim Lungenkrebs hingegen ist es noch nicht so lange her, dass wir diese Fortschritte haben und Patienten inzwischen längere Überlebenszeiten haben. Früher lag das mediane Überleben von Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs bei etwa einem Jahr. Das war unter ausschließlicher Chemotherapie. Im Median liegt die Überlebensrate mit Treibermutation und personalisierter Therapie in einzelnen Subgruppen heute schon bei fünf bis sechs Jahren. Wir haben inzwischen Patienten mit Treibermutationen, die seit elf Jahren mit dem Krebs leben, andere sterben weitaus früher. Die Überlebensraten der Patientinnen und Patienten unterscheiden sich auch innerhalb einer Treibermutationsgruppe sehr.
Die Barmer hat sich sehr früh auch finanziell für den Therapieansatz am CIO Köln starkgemacht. Wie viele Erkrankte mit Lungenkrebs können Ihre Testung heute in Anspruch nehmen?
Wolf: Inzwischen dürften etwa 50 Prozent aller deutschen Lungenkrebspatienten Zugang zu unserem kombinierten Behandlungsangebot aus Gendiagnostik und Therapie haben, aufgrund der besonderen Versorgungsverträge wäre die Erstattung für diese breite molekulare Diagnostik allerdings jetzt schon für circa 85 Prozent der Patienten möglich.
Wann ist Ihnen in Aus- und Weiterbildung zum Arzt und Facharzt das Thema Gendermedizin eigentlich zum ersten Mal begegnet?
Wolf: In meiner Weiterbildung zum Facharzt habe ich die Gendermedizin persönlich noch nicht wahrgenommen. Natürlich gibt es die Unterscheidung zwischen Mann und Frau in der Auswertung klinischer Studien schon seit Jahrzehnten. Seit etwa zehn Jahren fordern die Ethikkommissionen der Ärztekammern bei Studiendesigns auch die Auseinandersetzung mit möglichen Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Auch bei Anträgen für Forschungsgelder ist das Thema Gender inzwischen Standard
Wenn Sie aus Ihrer bisherigen langjährigen Tätigkeit eine Zwischenbilanz ziehen, wie fällt diese aus?
Wolf: Dass wir heute die spektakulärsten Erfolge im Kampf gegen Krebs bei Frauen sehen, die nie geraucht haben und an einem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom mit Treibermutationen leiden, das halte ich schon für eine ganz große Sache. Sie hat dazu beigetragen, dass der Lungenkrebs, der als vermeintliche „Raucherkrankheit“ früher ein absolutes Stiefkind der Forschungsförderung gewesen ist, aus der „Schmuddelecke“ herausgefunden hat. Die Amerikaner haben für diese Form der Stigmatisierung einst den prägnanten Begriff „dirty cancer“ geprägt – nach dem Motto: wer raucht, der ist selbst schuld. Ich habe diese Stigmatisierung von Menschen mit Lungenkrebs immer als zynisch empfunden, denn Lungenkrebs ist keine selbst verschuldete Erkrankung, sondern eine Folgeerkrankung einer Suchterkrankung, die in aller Regel schon in der Jugend beginnt und gerade in Deutschland nicht konsequent bekämpft wird. Zum Glück ist diese Stigmatisierung Geschichte und hat die Entwicklung dazu beigetragen, jetzt zunehmend auch das Leben von Männern zu retten.